
Jahrestagung in Erfurt 2024
Im schönen Ambiente der Räume der Katholischen Fakultät der Universität Erfurt fand vom 4. bis 6. April die Jahrestagung 2024 statt. Sieben spannende Vorträge und ein Festvortrag beleuchteten das Thema “Sakraltopographien in Thüringen”. Das frühlingshafte Wetter ermöglichte dazwischen erholsame Pausen in und um den Kreuzgang des benachbarten Mariendoms. Die Ehrengabe der Gesellschaft wurde Dr. Clemens Brodkorb, München, verliehen. Bischof Dr. Ulrich Neymeyr feierte mit den Teilnehmern ein Pontifikalamt im Dom.

Worms 1018 – 2018. Dom und Stadt
Neuer Band 150 der QAmrhKG erschienen
In seiner 1000-jährigen Geschichte hat der Wormser Dom ganz verschiedene Funktionen in der Stadt erfüllt: Als Ort der liturgischen Feier, als Ort der öffentlichen Kommunikation, als Ort der Identifikation, als Ort der Erinnerung. Diese vielfältigen Aspekte sind auf einem Symposium der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte erörtert worden, das zur Erinnerung an die im Jahr 1018 erfolgte Domweihe stattfand. Der zeitliche Horizont der hier publizierten Beiträge erstreckt sich von der Bauzeit unter Bischof Burchard bis ins 20. Jahrhundert. Thematisch geht es um den kulturellen und religiösen Kontext des Dombaus, Möglichkeiten der Rekonstruktion der mittelalterlichen Sakraltopographie, die Auswertung von Baugerüsten als Quelle für die Baugeschichte, die öffentliche Funktion des Doms im Spätmittelalter, das Zusammenleben verschiedener Konfessionen in der Stadt nach der Reformation, das spannungsvolle Verhältnis zwischen dem Dom und der städtischen Erinnerung an Martin Luthers Auftritt auf dem Reichstag im Jahr 1521, die Rolle des Doms im nationalen Überschwang der Reichsgründung und in den Auseinandersetzungen des Kulturkampfes und die nicht immer einfache Kommunikation zwischen Klerus und Gemeinde am zur Pfarrkirche im Bistum Mainz gewordenen Dom und dem Bischöflichen Ordinariat.
Ludger Körntgen (Hg.),
Worms 1018 –2018. Dom und Stadt
(Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 150). Münster: Aschendorff, 2024, 266 Seiten, gebunden, ISBN 978-3-402-26638-0, Preis 48,00 €

Wir möchten Sie auf zwei Veranstaltungen hinweisen:
Am 8. März findet an der Goethe-Universität Frankfurt ein von der Forschungsstelle für die Geschichte des Bistums Limburg veranstalteter Studientag statt.
Vom Paulskirchenparlament (1848) in die Dompfarrei (1849-1858). Der Tiroler Abgeordnete und Frankfurter Stadtpfarrer BEDA WEBER OSB
Programm und organisatorische Hinweise
Am 21. und 22. März findet an der RPTU Kaiserlautern eine Forschungstagung des Historischen Vereins der Pfalz in Verbindung mit der Bistumsgruppe Speyer statt.
(Kein) Opium des Volkes
Religion im langen 19. Jahrhundert in der Pfalz und Nachbargebieten
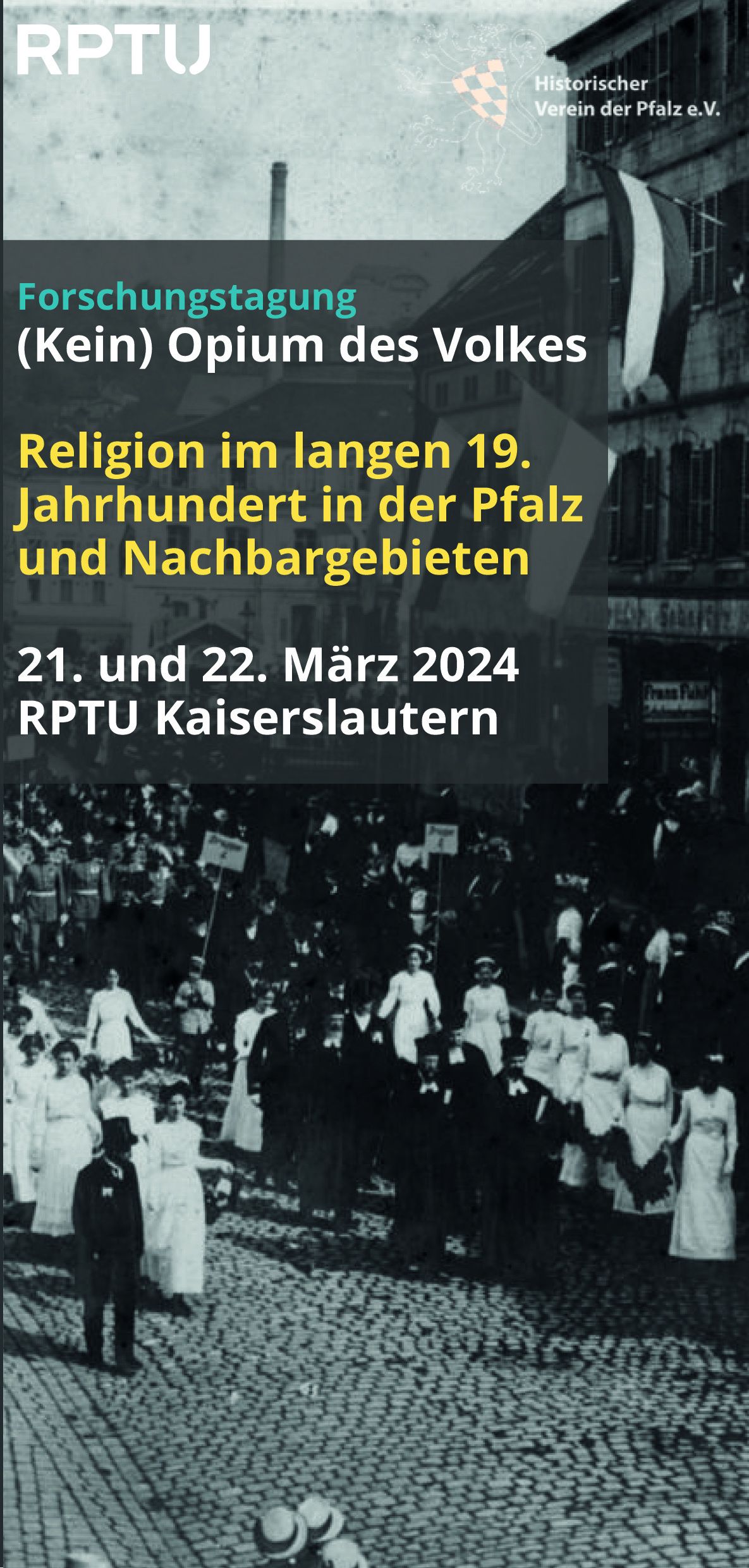

Jahrestagung 2024
Das Bistum Erfurt lädt herzlich ein zur Jahrestagung vom 4. bis 6. April 2024 in der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Die Tagung beleuchtet die Sakraltopographien in Thüringen. Das Programm und organisatorische Details finden Sie im Flyer. Der Anmeldeschluss ist der 15. Februar 2024.

ARCHIV FÜR MITTELRHEINISCHE KIRCHENGESCHICHTE 75 (2023) ERSCHIENEN
Das „Archiv“ ist wieder gefüllt mit kirchenhistorischen Abhandlungen, Beiträgen und Quellen aus dem Bereich der Bistümer Erfurt, Fulda, Limburg, Mainz, Speyer und Trier sowie Berichten der Kirchlichen Denkmalpflege. Die „Kirchenhistorische Chronik“ informiert über die aktuelle Lehr- und Forschungstätigkeit der (katholisch-)theologischen Hochschulen und Fakultäten in den genannten Diözesen.
Einen besonderen Schwerpunkt des diesjährigen Bandes bilden die Beiträge der Jahrestagung und des folgenden Studientags in Fulda 2022 mit neuen Forschungen zum Thema „1200 Jahre Michaelskirche in Fulda“. Die Beiträge werden von einem umfangreichen Tafelteil begleitet.
Der aktuelle Band ist im Buchhandel oder direkt beim Aschendorff Verlag erhältlich; Mitglieder erhalten ihn kostenlos.
Die Jubiläumstagung zum 75-jährigen Bestehen der GmrhKG fand im Mainzer Priesterseminar statt
Die Tagung, die unter dem Thema “Diözesangeschichte im deutschsprachigen Raum nach 1945. Aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen” stand, fand reges Interesse. Die Teilnehmer trafen sich am 10./11. November im Mainzer Priesterseminar, wo am 10. November 1948 die Gründungsversammlung stattgefunden hatte. Sie erfuhren viel Neues über die Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte, die Ziele der Forschungsstelle zur Limburger Bistumsgeschichte und den beeindruckenden Beitrag, den die diözesanen Archive, Bibliotheken und Museen zur Forschung leisten und vor welchen Herausforderungen sie zukünftig stehen.




Neu erschienen:
Neuaufbrüche und Friktionen.
200 Jahre Oberrheinische Kirchenprovinz 1821-2021
Hg. von Karl-Heinz Braun, Dominik Burkard und Bernhard Schneider
1821 errichtete Papst Pius VII. die Oberrheinische Kirchenprovinz. Ihr 200-jähriges Bestehen gibt den Anlass für einen vergleichenden Blick auf die schwierigen Anfänge und die wechselhafte Geschichte der Bistümer, die zu dieser Kirchenprovinz gehören (Freiburg, Mainz, Rottenburg-Stuttgart) oder bis 1929 dazu zählten (Fulda, Limburg). Institutionelle Entwicklungen, Pastoralkonzepte und -praxis, die Formierung eines sozial-karitativen Katholizismus sowie die Kirchenmusik werden erörtert. Als Außenperspektive dient das »preußische« Bistum Trier.
Mit Beiträgen von Claus Arnold, Klaus Baumann, Notker Baumann, Martin Belz, Daniela Blum, Hermann-Josef Braun, Joachim Bürkle, Dominik Burkard, Barbara Henze, Regina Heyder, Sabine Holtz, Wilbirgis Klaiber, Matthias T. Kloft, Agnes Löber, Philipp Müller, Christoph Nebgen, Christian Scharf, Uwe Scharfenecker, Christoph Schmider, Bernhard Schneider, Frederik Simon, Alessandra Sorbello Staub, Meinrad Walter, Siegfried Weichlein, Barbara Wieland, Karl-Heinz Braun
Verlag Herder, 2023, gebunden, 576 Seiten, 75 Euro, ISBN: 978-3-451-39821-6

Am 26. und 27. Januar 2024 findet in Landau folgende Tagung statt:
Erfolgsrezept oder Auslaufmodell?
Das Staatskirchenrecht in der deutschen Demokratie seit Konkordat und Staatskirchenvertrag in Bayern von 1924
Die Veranstaltung, die von der Evangelischen Akademie der Pfalz organisiert wird, findet in Kooperation mit der Speyerer Bistumsgruppe der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte und dem Verein für Pfälzische Kirchengeschichte statt.
Das Programm und organisatorische Hinweise finden Sie im Flyer.

Einladung zu Vortrag und Buchvorstellung
Jan Turinski
Leichenpredigten und Trauerzeremoniell der geistlichen Kurfürsten.
Studien zum Bischofsideal und zur Sepulkralkultur in der Germania sacra zwischen Westfälischem Frieden und Säkularisation.
(= Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 147). Münster 2023
Donnerstag, 9. November 2023, 18:30 Uhr
Martinus-Bibliothek, Grebenstr. 8, Mainz
Sie sind herzlich eingeladen; der Eintritt ist frei.

Nachruf auf Martina Wagner M.A.
Die Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte trauert um ihr langjähriges Mitglied und ihr Verwaltungsratsmitglied Frau Martina Wagner.
Martina Wagner nahm nach einem Studium der Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie der Neueren Geschichte und der anschließenden Ausbildung für den gehobenen Archivdienst zum 1. März 1993 ihre Arbeit im Diözesanarchiv Limburg auf. Dort übernahm sie 1999 zunächst die kommissarische Leitung und wirkte dann ab dem 1. Mai 2001 als Leiterin dieses Archivs bis zu ihrem krankheitsbedingten Ausscheiden im Herbst 2022.
Als Leiterin des Archivs hat Frau Wagner es auf vielen Feldern weiterentwickelt und auch den Umzug aus dem Ordinariat in die Räumlichkeiten der Diözesanbibliothek organisiert. Ein zentrales Projekt in ihrer Amtszeit war es, die Kirchenbücher für Nutzerinnen und Nutzer online zugänglich zu machen. Große Verdienste hat sich Frau Wagner durch die Sicherung, Unterbringung und Aufarbeitung zahlreicher Pfarrarchive erworben, deren Schätze so für die Nachwelt erhalten bleiben. In vielen Aufsätzen hat sie ihr großes Wissen um die Geschichte des Bistums und seiner zentralen Orte Limburg und Frankfurt der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte
Mit unserer Gesellschaft war Frau Wagner intensiv verbunden. Im April 2001 wurde sie in den Verwaltungsrat gewählt, in dem sie als Mitglied der Limburger Bistumsgruppe bis zum Ende des vergangenen Jahres kontinuierlich gewirkt hat. Die nachlassenden Kräfte aufgrund ihrer schweren Erkrankung erlaubten es ihr leider nicht mehr, diese fruchtbare Arbeit fortzusetzen. Umso dankbarer ist die Gesellschaft dafür, dass sie zusammen mit den übrigen Mitgliedern dieser Gruppe eine ganze Reihe von Jahrestagungen engagiert und kenntnisreich vorbereitet hat, u.a. zu Bischof Peter Josef Blum und zu Abt und Bischof Dominikus Willi. Zuletzt war sie federführend an der Planung zu der durch die Corona-Pandemie ausgefallenen Jahrestagung zur Leonhardskirche in Frankfurt beteiligt. Die Verdienste von Frau Wagner um die Erforschung der mittelrheinischen Kirchengeschichte wie um unsere Gesellschaft haben wir am 11. Januar diesen Jahres dadurch gewürdigt, dass sie aus den Händen von Dr. Gabriel Hefele und Prof. Dr. Matthias Kloft die Ehrengabe unserer Gesellschaft erhalten hat. Sie hat sich sehr darüber gefreut.
Mit Martina Wagner verliert unsere Gesellschaft eine Persönlichkeit, die uns mit ihrer bescheidenen, menschlich zugewandten Art und ihrer Expertise fehlen wird. Wir werden sie als liebenswürdigen, humorvollen und fröhlichen Menschen vermissen und sind mit ihrem Gatten und ihren Eltern in Trauer und Gebet verbunden. Bei der nächsten Jahrestagung werden wir ihrer besonders gedenken.
Bernhard Schneider, Präsident der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte

Einladung zur Tagung anlässlich des 75. Jahrestags der Gründung der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte
Diözesangeschichte im deutschsprachigen Raum nach 1945
Aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen
Die Tagung findet am 10./11. November 2023 im Priesterseminar des Bistums Mainz statt. Alle weiteren Informationen finden Sie im Flyer.
Am 10. November 1948 fand im Mainzer Priesterseminar die Gründungsversammlung der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte statt. Am 30. April 2019 wurde an der Goethe-Universität Frankfurt die Forschungsstelle für die Geschichte des Bistums Limburg feierlich eröffnet. Während die Gesellschaft als Zusammenschluss der kirchenhistorisch Interessierten im Mittelrheingebiet auf 75 Jahre ihres Bestehens zurückblicken kann, gilt die Aufmerksamkeit der jungen Forschungsstelle dem anstehenden Bistumsjubiläum im Jahr 2027 und der damit verbundenen zeitgemäßen Erforschung der geschichtlichen Entwicklungen im Diözesangebiet zwischen 1945 und 2016. In einer öffentlichen Tagung im Priesterseminar Mainz am 10. und 11. November 2023 wollen beide Institutionen den feierlichen Anlass nutzen, um kritisch auf Entwicklungslinien von „Diözesangeschichte“ im deutschsprachigen Raum nach 1945 zurückzublicken, zugleich aktuelle methodische und thematische Herausforderungen für regional orientierte Kirchengeschichte zu identifizieren und laufende Projekte vorzustellen. In den Blick genommen werden daher sowohl historiographische Aspekte als auch praktische Fragen, die sich bei der Erforschung und Vermittlung regionaler Kirchengeschichte stellen.


Reichstag – Reichsstadt – Konfession. Worms 1521
Neuen Band 148 der QAmrhKG vorgestellt
Am 13. März 2023 wurde die frisch erschienene Publikation zum Reichstag 1521 vorgestellt, die eine Tagung der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte vom Juni 2021 dokumentiert. Die Herausgeber, Prof. Dr. Claus Arnold als Leiter des Instituts für Mainzer Kirchengeschichte (IMKG), Dr. Martin Belz (wissenschaftlicher Mitarbeiter am IMKG) und Prof. Dr. Matthias Schnettger (Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Mainz) stellten gemeinsam mit anderen Beteiligten und Vertretern der Kooperationspartner den Band im Haus am Dom, Worms, der Öffentlichkeit vor.
Nach einem Grußwort von Propst Tobias Schäfer aus Worms erläuterten die drei Herausgeber die Ziele der Tagung von 2021 und führten in die einzelnen Beiträge des Bandes ein. Prof. Dr. Bettina Braun (Mainz), die den Schlusskommentar für den Band verfasst hat, zog ein kurzes Resümee zur Tagung und stellte den Band in den Kontext weiterer Veröffentlichungen zum Jubiläumsjahr 2021. Anschließend erläuterte Dr. Burkard Keilmann für den Altertumsverein Worms, der als Verein die Tagung und die Publikation mit initiiert hatte, die Bedeutung des Bandes für die Wormser Stadtgeschichte.
Zum Band:
Der Wormser Reichstag von 1521 ist vor allem wegen des Auftritts Martin Luthers im kulturellen Gedächtnis verankert. Dass der Reformator unter Berufung auf sein Gewissen vor Kaiser und Reichsständen den Widerruf seiner Schriften verweigerte, wurde und wird oft als Ursprung der neuzeitlichen Gewissensfreiheit gewürdigt und analysiert, und das mit gutem Grund. Doch abgesehen davon, dass der Reformator strenggenommen gar nicht auf dem Reichstag, sondern an dem in Worms befindlichen Kaiserhof auftrat, erschöpft sich die Bedeutung des Wormser Reichstags von 1521 nicht in dem „Luther-Moment“. Als erster Reichstag des frischgewählten Kaisers Karl V. steht er an einer Schnittstelle der Reichsgeschichte.
Vor diesem Hintergrund fassen die Beiträge des Bandes den Wormser Reichstag genauer in den Blick und stellen ihn zum einen in seine lokal- und reichsgeschichtlichen Kontexte. Zum anderen loten sie die Folgen der sich 1521 ankündigenden Glaubensspaltung für die Stadt Worms in ihrer Langzeitwirkung aus, bis hin zum „Wormser Memorandum“ von 1971. Sie dokumentieren damit eine Tagung der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte und zahlreicher Kooperationspartner von Juni 2021.
Bibliographische Angaben:
Arnold, Claus / Belz, Martin / Schnettger, Matthias (Hg.),
Reichstag – Reichsstadt – Konfession. Worms 1521
(Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 148). Münster: Aschendorff, 2023, 214 Seiten, gebunden, ISBN 978-3-402-26640-3, Preis 39,00 €


Konflikt – Konsens – Koexistenz.
Konfessionskulturen in Worms im 18. Jahrhundert
Mit einem spannenden Vortrag stellte Frau Dr. Carolin Katzer am 27. Januar 2023 im Liebfrauensaal des Wormser Kultur- und Tagungszentrums ihre gerade als Band 146 der Reihe „Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte“ erschienene Dissertation zum Thema „Konflikt – Konsens – Koexistenz. Konfessionskulturen in Worms im 18. Jahrhundert“ vor. Zusammen mit ihrem Doktorvater Prof. Dr. Matthias Schnettger gratulierten Prof. Dr. Claus Arnold, Vizepräsident der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte, Prof. Dr. Nebgen, Herausgeber der „Quellen und Abhandlungen“, und der Wormser Altertumsverein Frau Katzer zu ihrer gelungenen Arbeit, die eine große Forschungslücke der Wormser Stadt- und Kirchengeschichte schließt.
Das im Aschendorff-Verlag erschienene Buch ist über den Buchhandel zu beziehen. Mitglieder der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte erhalten es direkt beim Verlag zu einem um 30% ermäßigten Preis.

Priester – Volkslehrer – Zeremonienmeister.
Vom 29. bis 31. März 2023 findet unter Mitwirkung der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte in der Katholischen Akademie Mainz, Erbacher Hof, die internationale ökumenische Tagung
Priester – Volkslehrer – Zeremonienmeister. Katholische und evangelische ‘Geistliche’ in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
statt. Eine Einführung zum Thema und das Programm finden Sie im angehängten Flyer. Sie sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. Die Anmeldung erfolgt über die Akademie des Bistums Mainz/EBH: ebh.akademie@bistum-mainz.de

Einladung zu Buchvorstellung und Vortrag in Worms
Am Freitag, den 27. Januar 2023, um 19:00 Uhr, lädt die Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte und der Altertumsverein Worms alle Interessierten zur Buchvorstellung und zum Vortrag von Frau Dr. Carolin Katzer (Mainz) ein. Sie spricht zum Thema „Intoleranz und Religions-Einschränkung? – Katholiken, Lutheraner und Reformierte in Worms im 18. Jahrhundert“.
Der Vortrag basiert auf ihrer Dissertation, die Ende 2022 als Band 146 der Reihe “Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte” erschienen ist und an diesem Abend vorgestellt wird: Konflikt – Konsens – Koexistenz. Konfessionskulturen in Worms im 18. Jahrhundert. 508 Seiten, gebunden, ISBN 978-3-402-26631-1.
Die Veranstaltung findet statt im Liebfrauensaal des Wormser Tagungszentrums, Rathenaustr. 11; der Eintritt ist frei.
Der Vortrag wird auch via Zoom im Livestream übertragen:
https://us02web.zoom.us/j/83904458658?pwd=ZlhWSzhOVVFac3h5R2p1ZDRhS3Vadz09

Verleihung der Ehrengabe an Frau Martina Wagner M.A., Limburg
Aus gesundheitlichen Gründen musste Frau Martina Wagner, langjähriges Ratsmitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte, dieses Amt leider niederlegen. Im Auftrag des Präsidenten Professor Dr. Bernhard Schneider überreichten ihr ihre beiden Limburger Ratskollegen, Prof. Dr. Matthias Th. Kloft und Dr. Gabriel Hefele, in Vertretung des erkrankten Weihbischofs Dr. Löhr die Ehrengabe der Gesellschaft und dankten ihr herzlich für ihre über zwanzigjährige engagierte Tätigkeit in diesem Gremium.

Einladung nach Mainz zur 75. Jahrestagung
vom 13. bis 15. April 2023
Specialis vera filia?
Das (Erz-)Bistum Mainz und Rom
Die „besondere Tochter der römischen Kirche“ wird das goldene Mainz erstmals 1150 auf dem ersten Mainzer Stadtsiegel genannt. Die Versinschrift auf dem Ziborium des mittelalterlichen Hochaltars im Mainzer Dom erweiterte dies zur „besonderen, wahren Tochter“. Tatsächlich war das Verhältnis der Mainzer Kirche zu Rom speziell: Der Name von Erzbischof Bonifatius stand für das Programm einer romverbundenen fränkischen Landeskirche, die Mainzer Sakraltopographie bezog sich auf Rom und im 19. Jahrhundert wurde Mainz zum Zentrum einer romorientierten, „ultramontanen“ Theologie und Kirchenpolitik. Zugleich gab es aber immer auch Konflikte mit „Rom“ – zur Zeit der Reichskirche wie auch im 19. und 20. Jahrhundert. Die Tagung leuchtet dieses Spannungsverhältnis mit exemplarischen Schlaglichtern aus.
Die Details entnehmen Sie bitte dem Flyer.
Formular Abrufkontingent Hotel Ibis

Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 74 (2022) erschienen
Das „Archiv“ ist wieder gefüllt mit kirchenhistorischen Abhandlungen, Beiträgen und Quellen aus dem Bereich der Bistümer Erfurt, Fulda, Limburg, Mainz, Speyer und Trier sowie Berichten der Kirchlichen Denkmalpflege. Die „Kirchenhistorische Chronik“ informiert über die aktuelle Lehr- und Forschungstätigkeit der (katholisch-)theologischen Hochschulen und Fakultäten in den genannten Diözesen.
Einen Schwerpunkt des diesjährigen Bandes bilden die Beiträge zum Studientag in Speyer, der 2021 unter dem Titel „Bistum und Hochstift Speyer um 1500“ stattfand. Weitere Themen sind u.a.: das Erkanbald-Grab in der Mainzer Johanniskirche, archäologische Ausgrabungen in der Frankfurter Stiftskirche St. Leonhard, die Limburger theologische Fakultät, die landwirtschaftlichen Reformbemühungen eines Eifler Dorfpfarrers im 19. Jahrhundert, der Pfälzer Kirchenbaumeister Albert Boßlet (1880–1957) und die „Untergrundausbildung“ tschechischer Theologiestudenten in Erfurt von 1982 bis 1991.
Der aktuelle Band ist im Buchhandel oder direkt beim Aschendorff Verlag erhältlich; Mitglieder erhalten ihn kostenlos.

1200 Jahre Michaelskirche
Einladung zum Studientag nach Fulda oder in den virtuellen Raum
Bei unserer letzten Jahrestagung zum 1200jährigen Jubiläum der Fuldaer Michaelskirche wurde die Frage der Anastasis-Rotunde in der Michaelskirche angesprochen, allerdings nicht ausführlich behandelt.
Aufgrund der starken Nachfrage werden wir dieses Thema im Rahmen folgender Veranstaltung in Kooperation mit dem örtlichen Geschichtsverein aufgreifen:
Memoria und imitatio: Die Michaelskirche als Gedächtnisort und ihre Bezüge zur Jerusalemer Anastasis-Rotunde.
Mit Beiträgen von Ottfried Ellger (Münster), Gereon Becht-Jördens (Heidelberg), Christine Kenner (Wiesbaden), P. Nikodemus Schnabel, OSB (Jerusalem) und Winfried Weber (Trier).
Die Veranstaltung findet in Fulda im Kanzlerpalais am 6. Oktober 2022 von 18-20:30 Uhr statt.
Die Teilnahme ist auch online per Voranmeldung möglich.
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Flyer.
Herzliche Einladung nach Fulda bzw. in den virtuellen Raum!
Alessandra Sorbello Staub



1200 Jahre Michaelskirche in Fulda
Theologie und Architektur in einem Netzwerk europäischer Kultur
Die diesjährige Jahrestagung der Gesellschaft wurde vom 21. bis 23. April 2022 von der Fuldaer Bistumsgruppe ausgerichtet. Das Weihejubiläum der altehrwürdigen Michaelskirche bot den Anlass für die Tagung.
Der barocke Bibliothekssaal der Fuldaer Bibliothek, heute Auditorium maximum der Theologischen Fakultät, bot einen imposanten Rahmen für die Vortragsveranstaltungen. Eröffnet wurde die Tagung mit dem öffentlichen Vortrag von Prof. Dr. Marc-Aeilko Aris (München) zur Ideenwelt der karolingischen Kultur mit dem Titel „Architektur und Metapher“, in dem er sich mit der Vielschichtigkeit der Bezeichnung „sapiens architectus“ in biblischen Schriften, deren Exegese und in der Historiographie auseinandersetzte. Aris wurde im Anschluss mit der Ehrengabe der Gesellschaft ausgezeichnet. Die Laudatio hielt der Präsident der Gesellschaft, Prof. Dr. Bernhard Schneider.
In den wissenschaftlichen Vorträgen des zweiten Tages stand zunächst die geistesgeschichtliche Einordnung des Baus der Michaelskirche im Blickpunkt. Dr. Benjamin Pohl zeigte unter dem Titel „locus memoriae – locus historiae: Die Fuldaer Michaelskirche im Zentrum der monastischen Geschichts- und Erinnerungslandschaft“, dass Abt Eigil mit der von ihm initiierten Geschichtsschreibung und Bautätigkeit in Fulda eine Erinnerungslandschaft (memory scape) geschaffen hat, die Erinnerung konkret machte und zum Programm für weitere Generationen werden ließ.
Prof. Michael. I. Allen (Chicago) stellte mit Lupus von Ferrières einen vielfältig vernetzten Gelehrten des frühen 9. Jahrhunderts vor, der in der Zeit Hrabans mehrere Jahre in Fulda weilte und das Paradebeispiel für einen Philologen darstellt, durch den eine Reihe antiker Texte nach Fulda kamen und zwischen Bildungszentren der damaligen Zeit ausgetauscht wurden.
Dr. Gereon Becht-Jördens (Heidelberg) charakterisierte die Michaelskirche als ein Bauwerk ganz aus dem Geist des Hrabanus Maurus und stellte diesen als den Ideengeber für die Kirche vor, die sich als Bausymbolik der Überwindung innerer Konflikte im Kloster erweise.
Dipl. Restauratorin Christine Kenner erläuterte die Baugeschichte der Michaelskirche ausgehend von der karolingischen Zeit mit ihren Veränderungen in späteren Umbauphasen an den jeweiligen Befunden bis zu den letzten Restaurierungen und zeigte auch Bezüge zum Neubau der St. Andreas-Kirche in Fulda-Neuenberg unter Abt Richard (1020–1039) auf.
Über karolingische Architektur im Alpenraum der Schweiz referierte Prof. Dr. Jürg Goll (Müstair) und stellte damit die einzigartige Anlage von Müstair im oberen Vinschgau, die auf das Ende des 8. Jh. zurückgeht, in das Zentrum seiner Betrachtung.
Die Tradition der Anastasisrotunde in Jerusalem und ihre Nachahmung in Europa spielt für die Bewertung der Architektur der Michaelskirche eine wichtige Rolle, wie sowohl der Vortrag von Prof. Dr. Notker Baumann (Fulda/Marburg) als auch die abschließende Diskussion zeigte.
Eine besondere Erfahrung der Michaelskirche und ihrer Atmosphäre bot das abendliche Konzert mit Improvisationen für Percussion und Orgel von Martin Matl und Christopher Löbens sowie Meditationstexten von Michael Müller.
Die Exkursion führte in die St. Andreas-Kirche nach Fulda-Neuenberg, deren Krypta und ihr Bildprogramm aus dem 11. Jahrhundert die Restauratorin Christine Kenner präsentierte und damit auch Eindrücke vermitteln konnte, wie man sich im 11. Jahrhundert die Ausstattung der Michaelskirche mit Freskenmalerei vorstellen könnte.
Thomas Martin

Einladung zur Jahrestagung 2022 in Fulda
Sie finden unten das Einladungsschreiben von Herrn Weihbischof Professor Dr. Karlheinz Diez, das Programm inklusive organisatorischer Hinweise sowie das Anmeldeformular. Wenn Sie teilnehmen möchten, senden Sie das ausgefüllte Formular bis spätestens 31.03.2022 an: veranstaltungen@thf-fulda.de oder postalisch an Bibliothek des Priesterseminars Fulda, Domdechanei 4, 36037 Fulda.

Neu erschienen:
Band 145 der Quellen und Abhandlungen
Katholisch in 75 Jahren Rheinland-Pfalz
Personen, Orte, Ereignisse, Ideen
Hg. von Ulli Roth
391 Seiten, ISBN 978-3-402-26636-6, Preis 29,80 €
„Katholisch in 75 Jahren Rheinland-Pfalz“ bindet zum Landesjubiläum einen bunten Strauß aus 75 Blumen in Form von Kurzartikeln. Aus den Theologischen Fakultäten und Instituten, den Diözesanarchiven, geschichtlichen Forschungsstellen und historischen Vereinen und vielen anderen Akteuren der fünf Diözesen des Landes, Köln, Limburg, Mainz, Speyer und Trier, haben sich Autorinnen und Autoren quer durch das Land zusammengefunden. Sie lassen die letzten 75 Jahre Rheinland-Pfalz unter dem Gesichtspunkt „Katholisch“ bis in die Gegenwart in Schlaglichtern Revue passieren. So heben sie den Reichtum der jüngsten Landesgeschichte hervor, der oftmals über die lokale Bedeutsamkeit in gesamtdeutsche oder globale Relevanz hinausreicht. Dazu beleuchtet der Band Personen, Orte, Ereignisse und Ideen in kurzen Porträts und mit eindrücklichen Bildern. In unserer zunehmend kurzatmiger und disparater werdenden Zeit bedarf es auch des Zuspruchs einer reichen, gemeinsam geteilten Herkunft.
Nachruf auf Prof. Dr. Joachim Schmiedl ISch
(18. Dezember 1958 – 10. Dezember 2021)
Die Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte trauert um ihr langjähriges Mitglied und ihr Verwaltungsratsmitglied Prof. Dr. Joachim Schmiedl ISch.
Joachim Schmiedl trat 1977 in das Institut der Schönstatt-Patres ein und studierte nach dem Noviziat von 1980 bis 1987 an der Westfälischen-Wilhelms-Universität Theologie. Er wurde dort 1988 mit einer von Prof. Dr. Arnold Angenendt betreuten Dissertation über Marianische Religiosität in Aachen im 19. Jahrhundert promoviert. Im selben Jahr empfing er die Priesterweihe und war bis 1998 an verschiedenen Orten in der Seelsorge tätig. Parallel nahm er ein 1998 abgeschlossenes Habilitationsprojekt auf, mit dem er zur weitreichenden Bedeutung des II. Vatikanischen Konzils für die Orden forschte.
Als akademischer Lehrer wirkte Joachim Schmiedl seit 1998 an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar. Zunächst nahm er einen Lehrauftrag wahr und hatte ab 2001 dort die Professur für Mittlere und Jüngere Kirchengeschichte inne. Seiner Hochschule diente er auch als Dekan und Studiendekan der Theologischen Fakultät. Von 2017 bis 2020 war er Vorsitzender des Katholisch-Theologischen Fakultätentages. In der akademischen Welt sorgten von Schmiedl angeregte und geleitete ambitionierte Forschungsprojekte und eine Fülle von Publikationen vornehmlich zur Kirchengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts für höchste Anerkennung und Wertschätzung. Er war weltweit in der Forschungsgemeinschaft hervorragend vernetzt und bei Tagungen und sonstigen Veranstaltungen ein viel beachteter Experte. Mit seinen Projekten zur Konzilsrezeption, zur Gemeinsamen Synode der Bistümer Deutschlands und zu den europäischen Synoden seit dem II. Vatikanischen Konzil sowie zahlreichen einzelnen Forschungsbeiträgen gab er vielfältige Anstöße für die aktuellen Bemühungen, um eine Erneuerung der Kirche. Seine Stimme und fundierten Argumente hatten entsprechend Gewicht bei dem von den deutschen Bischöfen initiierten Gesprächsprozess ebenso bei den Beratungen der Trierer Diözesansynode oder aktuell bei denen des Synodalen Wegs.
Seine schier unerschöpfliche Schaffenskraft stellte er seiner Gemeinschaft und dem Bistum Trier auch für einige Seligsprechungsverfahren zur Verfügung. Seit 1997 arbeitete er an der Vorbereitung des Seligsprechungsprozesses für Josef Kentenich mit, seit 2003 war er Vizepostulator im Seligsprechungsprozess für Josef Engling sowie Leiter der Historischen Kommission im Seligsprechungsprozess für Franz Reinisch. Außerdem war er von 1998 bis 2001 Generalsekretär der Schönstatt-Patres.
Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte
Mit seiner Tätigkeit in Vallendar stand dem gebürtigen Franken auch der mittelrheinische Raum mit seinem reichen kirchlichen Erbe vor Augen. Über Jahrzehnte war er Mitglied in unserer Gesellschaft und seit 2009 Herausgeber der Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte. In dieser Eigenschaft gehörte er auch dem Verwaltungsrat an und hat auch dort seine Erfahrungen, sein kluges Urteil und seine vielfältigen Kontakte fruchtbar gemacht. In der Zeit seiner Herausgeberschaft hat er fast 20 Bände dieser Schriftenreihe verantwortungsvoll betreut und bis zum Erscheinen begleitet. Bis zuletzt stand er mit Autoren und Autorinnen im Kontakt, um weitere Bände zur Veröffentlichung zu führen. 2014 hat Prof. Schmiedl für unsere Gesellschaft in Kooperation mit der Akademie des Bistums Mainz eine wichtige Tagung zum Gedenken an das Zweite Vatikanische Konzil organisiert und so wesentlich dazu beigetragen, eine Forschungslücke zu schließen. Die Ergebnisse hat er umgehend als Band 137 der Quellen und Abhandlungen unter dem Titel „Der Tiber fließt in den Rhein. Das Zweite Vatikanische Konzil in den mittelrheinischen Bistümern“ schon im Folgejahr publiziert.
Mit Joachim Schmiedl verliert unsere Gesellschaft eine herausragende Persönlichkeit, die uns mit ihrer Tatkraft und wertvollen Impulsen schmerzlich fehlen wird. Wir werden ihn als liebenswürdigen, humorvollen Menschen vermissen und sind mit seiner Familie und der Gemeinschaft der Schönstatt-Patres in Trauer und Gebet verbunden. Bei der nächsten Jahrestagung werden wir seiner besonders gedenken.
Bernhard Schneider, Präsident der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte












